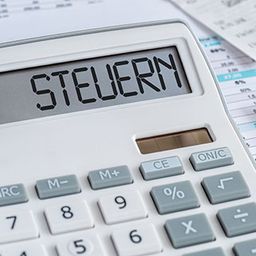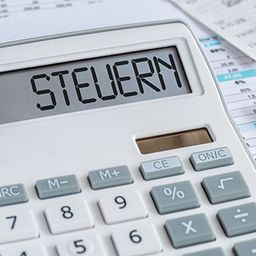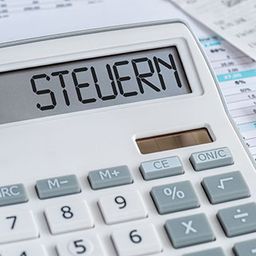Finanzverwaltung verlängert Billigkeitsmaßnahmen bei Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge durch Wohnungsunternehmen
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben ihre aus dem Jahr 2022 stammende Billigkeitsmaßnahme im Zusammenhang mit der Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge durch Wohnungsunternehmen bis zum 31.12.2024 verlängert. Danach erhalten Vermietungsunternehmen auch dann die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, wenn Wohnungsgenossenschaften an ukrainische Kriegsflüchtlinge unter bestimmten Voraussetzungen zusätzliche Leistungen erbringen, die über eine reine Vermietung von Wohnraum hinausgehen. Die aktuellen Erlasse ergehen im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministerium.Hintergrund: Vermietungsgesellschaften, die kraft ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtig sind (z.B. als GmbH), sind hinsichtlich ihres Gewinns aus der Vermietung von der Gewerbesteuer befreit, wenn sie ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen oder nebenbei noch bestimmte weitere Tätigkeiten ausüben wie z.B. eigenes Kapitalvermögen verwalten. Tätigkeiten, die darüber hinausgehen, sind nach dem Gesetz aber grundsätzlich schädlich und führen zur Versagung der erweiterten Gewerbesteuerkürzung. Wesentlicher Inhalt des Schreibens der obersten Finanzbehörden: Die Finanzämter werden aus Billigkeitsgründen bis zum 31.12.2024 nicht prüfen, ob die Vermietung von möbliertem Wohnraum an ukrainische Kriegsflüchtlinge zur Gewerblichkeit und damit zur Versagung der erweiterten Gewerbesteuerkürzung führt. Hinweis: Diese Aussage der Finanzverwaltung ist streng genommen wohl rechtswidrig, weil die Finanzverwaltung kraft Gesetzes zur Aufklärung des steuerlich relevanten Sachverhalts verpflichtet ist. Billigkeitsmaßnahmen sind im Einzelfall zwar möglich, erfordern aber ebenfalls eine vorherige Sachverhaltsaufklärung. Sollte es also z.B. aus anderen Gründen zu einem Klageverfahren beim Finanzgericht kommen, muss damit gerechnet werden, dass sich das Finanzgericht nicht an die Billigkeitsregelung der Finanzverwaltung hält und daher die erweiterte Gewerbesteuerkürzung versagt. Richtigerweise müsste der Gesetzgeber tätig werden, zumal der Krieg nun schon seit mehr als 1,5 Jahren andauert. Vermietet ein Wohnungsunternehmen Räume an eine juristische Person des öffentlichen Rechts, z.B. an eine Gemeinde, die die Räume an ukrainische Kriegsflüchtlinge überlässt, gelten die ukrainischen Kriegsflüchtlinge in den Erhebungszeiträumen 2022 bis einschließlich 2024 aus Billigkeitsgründen als (mittelbare) Mieter. Dies hat zur Folge, dass an sie z.B. Kleidung oder Nahrungsmittel verkauft werden können, ohne dass dies gewerbesteuerlich zur Versagung der erweiterten Kürzung führt: Voraussetzung für die gewerbesteuerliche Unschädlichkeit ist aber, dass die Verkaufseinnahmen maximal 5 % der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des gesamten Grundbesitzes betragen. Hinweis: Auch diese Billigkeitsregelung erscheint nicht gerichtsfest, könnte also bei einem finanzgerichtlichen Streit vom Finanzgericht gekippt werden. Denn der Gesetzgeber verlangt Einnahmen aus einer unmittelbaren Vertragsbeziehung. Die unmittelbare Vertragsbeziehung besteht aber nur mit der Gemeinde, an die das Gebäude vermietet wird, nicht hingegen mit dem Kriegsflüchtling, an den Nahrung oder Kleidung verkauft wird und dem eine Wohnung von der Gemeinde überlassen wird. Erzielt das Wohnungsunternehmen Erträge aus sonstigen Unterstützungsleistungen wie z.B. dem Verkauf von Nahrungsmitteln oder Kleidung, ist dies nach dem Gesetz nur dann gewerbesteuerlich unschädlich, wenn die Erträge aus Verkäufen an die Mieter resultieren und wenn die Einnahmen hieraus maximal 5 % der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des gesamten Grundbesitzes betragen. Hinweis: Dieser Punkt ist keine Billigkeitsregelung, sondern ein Hinweis auf ein gewerbesteuerliches Risiko. Verkäufe von Kleidung oder Nahrung an ukrainische Kriegsflüchtlinge, die nicht Mieter sind, führen nämlich zur Versagung der erweiterten Gewerbesteuerkürzung. Es wird dann der gesamte Vermietungsgewinn der Gewerbesteuer unterworfen. Quelle: Gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 17.10.2023 – FM3-G 1425-4/4; NWB