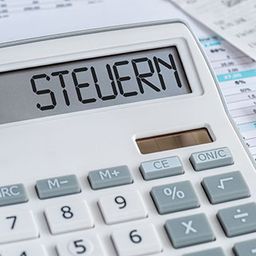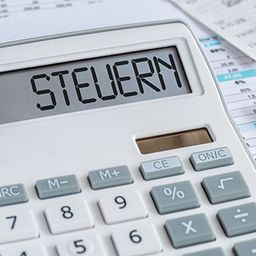
Videoverhandlung beim Finanzgericht mit Bildschirm im Rücken der Beteiligten
Eine Videoverhandlung beim Finanzgericht (FG) verletzt das Recht auf rechtliches Gehör, wenn sich der Videobildschirm, auf dem der Prozessgegner zu sehen ist, im Rücken eines Prozessbeteiligten im Sitzungssaal befindet, so dass sich der Prozessbeteiligte immer umdrehen muss, um den Prozessgegner zu sehen. Hintergrund: Eine mündliche Verhandlung beim Finanzgericht kann in Gestalt einer Videokonferenz durchgeführt werden. Der Kläger und sein Bevollmächtigter oder auch der Beklagte (Finanzamt) sind dann im Sitzungssaal im Gericht nicht persönlich anwesend, sondern nehmen per Videoübertragung an der Verhandlung teil. Sachverhalt: Die Klägerin klagte gegen das Finanzamt. Es kam zu einer Videoverhandlung im Finanzgericht, bei der die Klägerin im Sitzungssaal saß, während das Finanzamt per Video zugeschaltet war. Der Bildschirm, auf dem der Finanzamtsvertreter zu sehen war, befand sich im Rücken der Klägerin, die Richterbank stand hingegen vor ihr. Die Klägerin musste sich daher um 180 Grad wenden, um den Finanzamtsvertreter auf dem Bildschirm zu sehen. Die Klägerin verlor ihre Klage und erhob gegen das Urteil Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof (BFH). Entscheidung: Der BFH gab der Nichtzulassungsbeschwerde statt, hob das Urteil des FG auf und verwies die Sache an das FG zur weiteren Entscheidung zurück: Die Videoverhandlung beim FG hat den Anspruch der Klägerin auf das rechtliche Gehör verletzt. Zum rechtlichen Gehör bei einer Videoverhandlung gehört es nämlich, dass der Prozessbeteiligte zeitgleich die Richterbank und die anderen Prozessbeteiligten sehen und hören kann. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn die Klägerin den zugeschalteten Finanzamtsvertreter nur dann sehen kann, wenn sie sich um 180 Grad dreht. Denn dann kann die Klägerin nicht zugleich die Richterbank sehen und bekommt nicht mit, ob sich zwischen der Richterbank und dem Finanzamtsvertreter eine nonverbale Kommunikation durch Mimik oder Gestik entwickelt. Zwar muss die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör grundsätzlich gerügt werden, weil auf diesen Anspruch verzichtet werden kann; ohne Rüge kommt es zu einem Rügeverlust, so dass eine Nichtzulassungsbeschwerde nicht auf einen Verfahrensfehler gestützt werden kann. Das Rügeerfordernis gilt aber nicht, wenn der Prozessbeteiligte – wie im Streitfall – nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten wird. Denn als Laie konnte sie das Rügeerfordernis nicht erkennen. Hinweise: Das FG muss nun neu über die eigentliche Streitfrage, zu der sich der BFH nicht geäußert hat, entscheiden.Der BFH hat bereits vor kurzem entscheiden, dass der extern zugeschaltete Prozessbeteiligte bei einer Videoverhandlung die gesamte Richterbank während der überwiegenden Dauer der Verhandlung auf dem Bildschirm sehen muss und nicht nur einen einzelnen Richter, etwa den Vorsitzenden. Anderenfalls ist das Gericht nicht ordnungsgemäß besetzt, weil der Prozessbeteiligte nicht erkennen kann, ob die Richter pünktlich erscheinen oder vorübergehend den Sitzungssaal verlassen oder auch einschlafen. Bei der ordnungsgemäßen Besetzung handelt es sich um einen sog. absoluten Revisionszulassungsgrund, so dass eine Rüge nicht erforderlich ist. Quelle: BFH, Beschluss vom 18.8.2023 – IX B 104/22; NWB