Aktuelles
-

Vorsteuerabzug einer Holding
Eine unternehmerisch tätige Holding, die sich an anderen Gesellschaften beteiligt und gegen Entgelt Geschäftsführungsleistungen erbringt, kann Vorsteuer aus Eingangsleistungen, die an sie erbracht worden sind, nicht geltend machen, wenn sie diese Eingangsleistungen als Gesellschafterbeitrag unentgeltlich an die Tochtergesellschaft erbringt und die Eingangsleistungen mit den Umsätzen der Tochtergesellschaft, nicht aber mit den Geschäftsführungsleistungen der Holding in Zusammenhang stehen. Hintergrund: Die Vorsteuer ist abziehbar, wenn der Unternehmer Leistungen für sein Unternehmen bezieht und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Sachverhalt: Die Klägerin war eine Holding, die an mehreren Tochtergesellschaften beteiligt war, ohne dass eine umsatzsteuerliche Organschaft bestand. Die Tochtergesellschaften tätigten umsatzsteuerfreie Umsätze aus Grundstücksverkäufen und waren daher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die Klägerin erbrachte gegenüber ihren Tochtergesellschaften umsatzsteuerpflichtige Geschäftsführungs- und Buchführungsleistungen. Die Klägerin hatte sich im jeweiligen Gesellschaftsvertrag der Tochtergesellschaften verpflichtet, unentgeltliche Dienstleistungen an die Tochtergesellschaften zu erbringen. Sie bezog und bezahlte u.a. Architekten- und Erschließungsdienstleistungen, die für die Grundstücksgeschäfte der Tochtergesellschaften nützlich waren und überließ diese Dienstleistungen den Tochtergesellschaften unentgeltlich. Die Vorsteuer aus diesen Leistungen erkannte das Finanzamt nicht an. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage ab: Zwar war die Klägerin als sog. geschäftsleitende Holding Unternehmerin und damit grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berechtigt. Sie erbrachte nämlich Geschäftsführungs- und Buchführungsdienstleistungen gegen Entgelt. Allerdings gehörte die Erbringung der Architekten- und Erschließungsdienstleistungen nicht zur unternehmerischen Tätigkeit der Klägerin. Denn die Klägerin verwendete die bezogenen Architekten- und Erschließungsdienstleistungen nicht für ihre unternehmerisch erbrachten Geschäftsführungs- und Buchführungsdienstleistungen; die Architekten- und Erschließungsdienstleistungen gingen auch weder in den Preis für die Geschäftsführungs- und Buchführungsdienstleistungen ein, noch gehörten die Architekten- und Erschließungsdienstleistungen zu den allgemeinen Aufwendungen der Holding. Vielmehr standen die Architekten- und Erschließungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den umsatzsteuerfreien Grundstücksverkäufen der Tochtergesellschaften. Hinweise: Die Tochtergesellschaften hätten zwar die von der Klägerin eingebrachten Architekten- und Erschließungsdienstleistungen selbst beziehen können; dennoch hätten sie die Vorsteuer nicht geltend machen können, da sie umsatzsteuerfreie Grundstücksverkäufe tätigten und damit vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen waren. Mit der gewählten Konstruktion sollte der Klägerin als Holding der Vorsteuerabzug ermöglicht werden. Ob dies ein Gestaltungsmissbrauch darstellt, konnte offen bleiben, da der Vorsteuerabzug der Klägerin bereits nach allgemeinen Grundsätzen zu versagen war. Der BFH hatte den Europäischen Gerichtshof (EuGH) angerufen, der einen Vorsteuerabzug abgelehnt hat. Im aktuellen Urteil ist der BFH der Entscheidung und Begründung des EuGH gefolgt. Quelle: BFH, Urteil v. 15.2.2023 – XI R 24/22 (XI R 22/18); NWB
-

Vorsteuerabzug aus den Kosten für eine Betriebsveranstaltung
Der Vorsteuerabzug aus den Kosten für eine Betriebsveranstaltung ist grundsätzlich nur möglich, wenn es entweder ein vorrangiges Unternehmensinteresse für die Betriebsveranstaltung gibt, das über die Verbesserung des Betriebsklimas hinausgeht, oder wenn die Kosten pro erschienenen Teilnehmer nicht höher als 110 € sind. Hintergrund: Die Vorsteuer ist abziehbar, wenn der Unternehmer Leistungen für sein Unternehmen bezieht und eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Wird die bezogene Leistung für den Privatbedarf der Arbeitnehmer verwendet, ist die Vorsteuer grundsätzlich nicht abziehbar. Einkommensteuerlich gibt es seit 2015 einen Freibetrag in Höhe von 110 € für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen. Der Freibetrag gilt pro Arbeitnehmer und ggf. dessen Begleitung. Er wird für bis zu zwei Veranstaltungen pro Jahr gewährt. Bis einschließlich 2014 galt eine Freigrenze in Höhe von 110 €, so dass bei Überschreitung dieser Freigrenze der gesamte Betrag als Abeitslohn steuerpflichtig war. Sachverhalt: Der Kläger war Arbeitgeber und lud seine Mitarbeiter im Jahr 2015 zu einer Weihnachtsfeier ein, die in Gestalt eines sog. Kochevents in einem Kochstudio durchgeführt werden sollte. Es meldeten sich 32 Arbeitnehmer an; tatsächlich erschienen 31 Arbeitnehmer. Die Kosten betrugen brutto ca. 4.500 €. Auf jeden Teilnehmer entfielen ca. 150 €. Das Finanzamt erkannte die Vorsteuer nicht an. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hiergegen gerichtete Klage ab: Der Vorsteuerabzug aus den Kosten für eine Betriebsveranstaltung setzt grundsätzlich ein vorrangiges Unternehmensinteresse voraus. Allein die Verbesserung des Betriebsklimas genügt nicht. Im Streitfall ging es lediglich um die Verbesserung des Betriebsklimas, so dass ein Vorsteuerabzug unter Hinweis auf ein vorrangiges Unternehmensinteresse nicht möglich ist. Ein Vorsteuerabzug ist allerdings auch dann möglich, wenn die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung als Aufmerksamkeit – und nicht als Entnahme – zu werten ist. Von einer Aufmerksamkeit ist im Zusammenhang mit einer Betriebsveranstaltung auszugehen, wenn die Kosten pro erschienenen Arbeitnehmer nicht höher sind als 110 €. Dieser Betrag resultiert aus dem Lohnsteuerrecht, das bis einschließlich 2014 eine Freigrenze von 110 € vorsah und seit 2015 einen Freibetrag in Höhe von 110 €. Allerdings ist umsatzsteuerlich weiterhin von einer Freigrenze auszugehen und nicht von einem Freibetrag. Denn Aufmerksamkeiten sind geringfügige Zuwendungen. Bei Ansatz eines Freibetrags wäre indes eine aufwendige Betriebsveranstaltung teilweise, nämlich bis zu einem Betrag von 110 €, umsatzsteuerlich begünstigt. Bei der Ermittlung der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallenden Kosten sind auch die Kosten für den äußeren Rahmen wie z.B. die Raumkosten einzubeziehen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich um eine einheitliche Leistung handelt. Im Streitfall lag mit dem Kochevent eine solche einheitliche Leistung in Gestalt eines marktfähigen Gesamtpakets vor, das sich aus dem Kochen und Verzehren der selbst zubereiteten Speisen in gehobenem Ambiente zusammensetzte; die Minderung der Gesamtkosten um die Raumkosten würde zu einer künstlichen Aufspaltung dieser Gesamtleistung führen. Da auf jeden Teilnehmer ca. 150 € Kosten entfielen, war die Freigrenze von 110 € überschritten, so dass die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung keine Aufmerksamkeit darstellte, sondern eine Entnahme. Damit war der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Hinweise: Der BFH hält umsatzsteuerlich daran fest, dass Betriebsveranstaltungen nur dann umsatzsteuerlich unschädlich sind, wenn pro Arbeitnehmer der Kostenanteil maximal 110 € beträgt. Eine Überschreitung dieses Betrags auch nur um einen Euro würde zum Ansatz einer Entnahme und damit zur Versagung des Vorsteuerabzugs führen. Der BFH folgt damit nicht der einkommensteuerlichen Änderung des Gesetzes, wonach seit 2015 ein Freibetrag – und nicht eine Freigrenze – von 110 € gilt. Außerdem stellt der BFH klar, dass umsatzsteuerlich die Kosten der Betriebsveranstaltung auf die erschienenen Arbeitnehmer aufzuteilen sind und nicht auf die angemeldeten Teilnehmer. Dies ist nachteilig, weil sich hierdurch der auf den einzelnen Teilnehmer entfallende Kostenanteil erhöhen kann. Quelle: BFH, Urteil v.10.5.2023 – V R 16/21; NWB
-
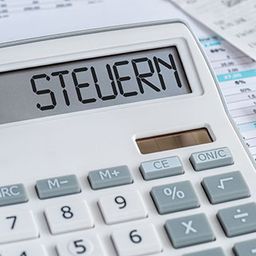
Finanzverwaltung äußert sich zur Steuerbefreiung kleinerer Photovoltaikanlagen
Der Gesetzgeber hat rückwirkend zum 1.1.2022 den Betrieb kleinerer Photovoltaikanlagen steuerfrei gestellt. Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat nun zu Einzelfragen der Steuerbefreiung Stellung genommen. Die wichtigsten Punkte stellen wir Ihnen hier vor. Hintergrund: Rückwirkend zum 1.1.2022 wurden Gewinne aus dem Betrieb kleinerer Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von maximal 30 kW (peak) steuerfrei gestellt. Befinden sich in einem Gebäude mehrere Wohnungen oder Geschäfte, ist eine Leistung von 15 kW pro Wohn- bzw. Geschäftseinheit zulässig. Maximal darf pro Steuerpflichtigen jedoch eine Leistung von 100 kW insgesamt nicht überschritten werden. Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: Die zulässigen Höchstwerte von 30 kW pro Einfamilienhaus bzw. 15 kW pro Wohn- bzw. Geschäftseinheit gelten pro Steuerpflichtigen. Beispiel: Sowohl die Ehefrau als auch der Ehemann betreiben jeweils eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 16 kW auf ihrem Einfamilienhaus. Da für jeden der beiden eine Höchstgrenze von 30 kW gilt, sind beide Anlagen steuerfrei. Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sind nicht steuerfrei, selbst wenn sie die Maximalwerte von 15 kW bzw. 30 kW nicht überschreiten. Die Steuerbefreiung erfordert nicht, dass der Betreiber auch Eigentümer des Gebäudes ist, auf dem sich die Anlage befindet. Die Steuerbefreiung gilt nicht nur für die Einnahmen, sondern auch für Entnahmen, wenn z.B. der produzierte Strom zum Teil in den selbstgenutzten Wohnräumen verwendet wird. Bei der Prüfung, ob die Maximalgrenze von 100 kW überschritten wird, sind nur solche Anlagen einzubeziehen, die an sich unter die Steuerbefreiung fallen. Beispiel: A betreibt zwei Anlagen mit einer Leistung von jeweils 30 kW auf Einfamilienhäusern und eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 100 kW. Da die Freiflächen-Photovoltaikanlage ohnehin nicht steuerfrei ist, verbleiben nur die beiden Anlagen auf den beiden Einfamilienhäusern mit insgesamt 60 kW. Die Maximalgrenze von 100 kW pro Steuerpflichtigen wird nicht überschritten. Die Voraussetzungen der Steuerfreiheit können auch im Lauf eines Jahres eintreten oder aber wegfallen, weil z.B. die Maximalgrenze von 100 kW überschritten bzw. nicht mehr überschritten wird. In diesem Fall besteht die Steuerfreiheit nur bis zum Eintreten der Voraussetzungen oder aber bis zum Wegfall der Voraussetzungen. Hinweis: Durch die Aufteilung eines Gebäudes in mehrere Einheiten können die Voraussetzungen der Steuerfreiheit geschaffen werden. Dies ist etwa der Fall, wenn auf einem Gebäude mit zwei Einheiten eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 32 kW betrieben wird (die Grenze von 30 kW wird überschritten) und zum 1.8. des Jahres eine weitere Einheit durch Aufteilung einer der beiden Einheiten entsteht. Bei drei Einheiten kann nun eine Leistung von 45 kW statt bislang lediglich 30 kW (bei zwei Einheiten) steuerfrei erzielt werden. Ab dem 1.8. ist der Betrieb der Anlage daher steuerfrei. Ab dem 1.1.2022 kann ein Investitionsabzugsbetrag bei dem Betrieb einer steuerfreien Anlage nicht mehr gebildet werden. Denn es fehlt aufgrund der Steuerbefreiung an der Gewinnerzielungsabsicht. Der Abzug von Betriebsausgaben ist aufgrund der Steuerbefreiung nicht mehr möglich. Für Handwerkerleistungen, die an einer steuerfrei betriebenen Photovoltaikanlage am selbstgenutzten Haus durchgeführt werden, kann eine Steuerermäßigung von 20 % für Handwerkerleistungen im selbstgenutzten Haushalt geltend gemacht werden. Hinweise: Das aktuelle BMF-Schreiben ist für die Finanzämter bindend. Es gilt für alle Einnahmen und Entnahmen, die ab dem 1.1.2022 erzielt werden. Quelle: BMF-Schreiben v. 17.7.2023 – IV C 6 – S 2121/23/10001 :001; NWB
