Aktuelles
-

Berichtigung der Umsatzsteuer bei strafrechtlicher Einziehung von Bestechungsgeldern
Bestechungsgelder unterliegen der Umsatzsteuer. Wird von einem Strafgericht die Einziehung der Bestechungsgelder angeordnet, ist die Umsatzsteuer zugunsten des Täters zu berichtigen. Anderenfalls käme es zu einer Doppelbelastung durch Einziehung und Besteuerung der Bestechungsgelder. Hintergrund: Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist das Entgelt. Ändert sich das Entgelt später, z.B. wegen eines geltend gemachten Mangels, ist die Bemessungsgrundlage zu berichtigen, so dass sich auch die Umsatzsteuer mindert. Eine Berichtigung kann aber auch zuungunsten des Unternehmers erfolgen, wenn sich im Nachhinein das Entgelt erhöht. Sachverhalt: Der Kläger war als Ingenieur in einem Immobilienunternehmen beschäftigt und im Zeitraum 2011 bis 2014 für die Vergabe von Bauaufträgen zuständig. Er ließ sich für die Erteilung der Bauaufträge Bestechungsgelder bezahlen. Insgesamt erhielt er in den Jahren 2011 bis 2015 Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt ca. 340.000 €; auf das Streitjahr 2015 entfiel ein Teilbetrag von ca. 7.000 €. Nachdem die Bestechung aufgedeckt wurde, wurde der Kläger im Jahr 2020 zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren wegen Bestechlichkeit verurteilt; außerdem ordnete das Strafgericht die Einziehung der Bestechungsgelder in Höhe von 340.000 € an. Das Finanzamt setzte für das Streitjahr 2015 Umsatzsteuer fest, die es aus dem gezahlten Bestechungsgeld in Höhe von 7.000 € herausrechnete. Der Kläger beantragte eine Berichtigung der Umsatzsteuer und begründete dies damit, dass er im Jahr 2015 aufgrund der angeordneten Einziehung 12.000 € an die Landesjustizkasse gezahlt habe. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Kläger im Grundsatz Recht, verwies die Sache aber zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) zurück: Die Bestechungsgelder unterliegen der Umsatzsteuer, weil der Kläger wiederholt eine Leistung erbracht, nämlich Bauaufträge erteilt hat. Dass Bestechungen strafbar sind, ist für die Steuerbarkeit grundsätzlich unbeachtlich. Etwas anderes gilt nur dann, wenn es um kriminelle Leistungen geht, für die es keinen legalen Wirtschaftssektor gibt, wie dies etwa beim Verkauf von Drogen der Fall ist. Für die Vergabe von Bauaufträgen gibt es aber einen legalen Wirtschaftssektor, so dass Umsatzsteuer entsteht. Die Einziehung der Taterfolge (Bestechungsgelder) führt zu einer Berichtigung zugunsten des Klägers. Zwar setzt die Berichtigung an sich voraus, dass der Unternehmer die eingezogenen Beträge an den Leistungsempfänger (Bauunternehmer), der ihn bestochen hatte, zurückzahlt und nicht an die Justizkasse und damit an einen Dritten. Jedoch ist es verfassungsrechtlich geboten, eine Berichtigung zuzulassen. Denn ansonsten käme es zu einer Doppelbelastung des Täters durch Einziehung und durch Besteuerung des eingezogenen Betrags. Hinweise: Das Finanzgericht muss nun zunächst aufklären, ob im Streitjahr 2015 überhaupt Umsatzsteuer entstanden ist. Bei der Versteuerung nach vereinbarten Entgelten käme es darauf an, dass der Kläger im Jahr 2015 noch Bauaufträge erteilt hat; der Kläger war jedoch nach den bisherigen Feststellungen nur bis einschließlich 2014 für das Immobilienunternehmen tätig. Das Finanzgericht muss außerdem ermitteln, ob der Kläger im Streitjahr 2015 aufgrund der Einziehung in die Justizkasse eingezahlt hat. Denn die Einziehung wurde erst im Jahr 2020 angeordnet. Möglicherweise handelte es sich um eine Einzahlung aufgrund einer Beschlagnahme oder um einen Vermögensarrest; in diesem Fall wäre eine Berichtigung nicht vorzunehmen.Quelle: BFH, Urteil vom 25.9.2024 – XI R 6/23; NWB
-
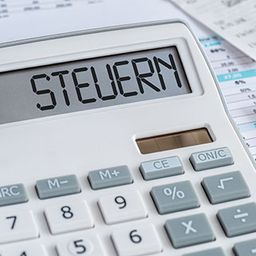
Kein Sonderausgabenabzug für Schulgeld in der Schweiz
Schulgeld für eine Privatschule in der Schweiz ist nicht als Sonderausgabe abziehbar. Denn Voraussetzung für einen Sonderausgabenabzug ist, dass die Schule in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) liegt. Hintergrund: 30 % des Schulgelds, maximal 5.000 €, sind als Sonderausgaben abziehbar. Voraussetzung ist, dass die Schule in der EU oder im EWR liegt. Außerdem muss die Schule zu einem allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führen, der in Deutschland als gleichwertig anerkannt wird. Der auf die Beherbergung, Betreuung und Verpflegung entfallende Teil des Schulgelds ist nach dem Gesetz nicht als Sonderausgabe abziehbar. Sachverhalt: Der Kläger ist Deutscher und wohnte im Streitjahr 2020 mit seiner Familie in der Schweiz. Er erzielte in Deutschland steuerpflichtige Einkünfte aus nichtselbständiger sowie freiberuflicher Tätigkeit. Sein im Jahr 2016 geborener Sohn S besuchte ab Januar 2020 einen Privatkindergarten mit Primarschule in der Schweiz; S war im Januar 2020 noch keine vier Jahre alt. Der Kläger machte das Schulgeld in Deutschland als Sonderausgaben geltend, welches das Finanzamt nicht anerkannte. Entscheidung: Das Finanzgericht Münster (FG) wies die hiergegen gerichtete Klage ab: Der Abzug als Sonderausgaben setzt voraus, dass es sich um eine Schule in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) handelt. Die Schweiz gehört jedoch weder zur EU noch zum EWR. Ein Sonderausgabenabzug ergibt sich auch nicht aus dem mit der Schweiz abgeschlossenen Freizügigkeitsabkommen (FZA). Das FZA untersagt eine steuerliche Ungleichbehandlung, wenn diese allein wegen des Wohnsitzwechsels von Deutschland in die Schweiz erfolgt. Hätte der Kläger aber mit seiner Familie in Deutschland gelebt, hätte er ebenfalls keine Sonderausgaben geltend machen können. Denn S war im Streitjahr 2020 noch gar nicht schulpflichtig. Der Sonderausgabenabzug ist aber erst mit dem Beginn der Schulpflicht möglich. Hinweise: Zwar ergibt sich aus dem Gesetz nicht ausdrücklich, dass das Kind schulpflichtig sein muss; allerdings hat der Bundesfinanzhof (BFH) eine Schulpflicht gefordert. Denn anderenfalls käme es zu einer Benachteiligung derjenigen Eltern, die ihre noch nicht schulpflichtigen Kinder in Kindergärten schicken und die dafür entstehenden Kosten nicht absetzen können.Außerdem ist der Teil des Schulgelds, der auf Beherbergung, Betreuung und Verpflegung entfällt, nach dem Gesetz nicht absetzbar; bei noch nicht schulpflichtigen Kindern steht aber die Betreuung im Vordergrund. Quelle: FG Münster, Urteil vom 14.11.2024 – 8 K 2742/22 E; NWB
-

Grunderwerbsteuer: Verlängerung der Beteiligungskette bei einer Personengesellschaft
Kommt es bei einer grundbesitzenden Personengesellschaft zu einer Verlängerung der Beteiligungskette, indem eine weitere Personengesellschaft als weitere mittelbare Gesellschafterin zwischengeschoben wird, an der die bisherigen Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligt sind, führt dies nicht zu einem grunderwerbsteuerbaren Gesellschafterwechsel. Hintergrund: Besitzt eine Personengesellschaft Grundbesitz und wird der Gesellschafterbestand der Personengesellschaft innerhalb von zehn Jahren unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % ausgetauscht, löst dies Grunderwerbsteuer aus. Bis zum 30.6.2021 entstand Grunderwerbsteuer nur dann, wenn der Gesellschafterbestand innerhalb von fünf Jahren zu mindestens 95 % unmittelbar oder mittelbar ausgetauscht wurde. Sachverhalt: Die Klägerin war eine GmbH & in Co. KG mit Grundbesitz. An der Klägerin war die X-KG über eine weitere KG mittelbar zu 100 % beteiligt. Gesellschafter der X-KG waren A mit 20 %, B mit 20 %, C mit 20 %, D mit 30 % und E mit 10 %. Im Jahr 2015 übertrug C ihren Söhnen D und E jeweils die Hälfte ihrer Beteiligung, so dass diese nun mit 40 % (D) bzw. 20 % (E) an der X-KG beteiligt waren. D brachte anschließend seine Beteiligung von 40 % in eine italienische Kapitalgesellschaft (Y) ein. E brachte zugleich seine Beteiligung von 20 % in eine andere italienische Kapitalgesellschaft (Z) ein. A und B brachten nun ihre jeweils 20%ige Beteiligung in die im Oktober 2015 gegründete W-KG ein, deren Kommanditisten A und B zu jeweils 50 % waren. Damit war die W-KG zu 40 % über die X-KG und eine weitere KG an der Klägerin beteiligt; die verbleibenden 60 % an der X-KG hielten die beiden italienischen Kapitalgesellschaften. Das Finanzamt sah diese Umstrukturierung als grunderwerbsteuerbar an, weil die mittelbaren Gesellschafter innerhalb von fünf Jahren zu mindestens 95 % ausgetauscht wurden; es beließ den Vorgang aber im Umfang von 40 % steuerfrei, weil A und B über die W-KG weiterhin zu jeweils 20 % mittelbar beteiligt blieben. Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hiergegen gerichteten Klage statt und verneinte die Grunderwerbsteuerbarkeit: Zwar wurden die mittelbaren Gesellschafter der Klägerin zu mindestens 95 % ausgetauscht, nämlich sogar zu 100 %. Der Übergang von 20 % der Anteile durch A und B auf die W-KG wird aber nicht als mittelbarer Gesellschafteraustausch berücksichtigt, weil A und B über die W-KG als Personengesellschaft weiterhin mittelbar an der Klägerin beteiligt blieben. Nach dem Gesetzeswortlaut werden Personengesellschaften bei der Regelung über den Austausch von Gesellschaftern zu mindestens 95 % (jetzt: 90 %) als transparent angesehen, so dass durch sie durchgeschaut wird. Schaut man durch die W-KG hindurch, bleiben A und B weiterhin mittelbar an der Klägerin beteiligt. Bei der Prüfung der Grunderwerbsteuerbarkeit müssen somit auch die Beteiligungsverhältnisse auf höheren Beteiligungsebenen, d.h. auf weiteren mittelbaren Beteiligungsebenen, berücksichtigt werden. Danach bleiben A und B an der Klägerin zu insgesamt 40 % mittelbar beteiligt. Hinweise: Im Ergebnis kam es somit nur zu einem Austausch der mittelbaren Gesellschafter im Umfang von 60 %, so dass die erforderliche Quote von mindestens 95 % nicht erreicht wurde. Durch die (italienischen) Kapitalgesellschaften kann nicht hindurchgeschaut werden, da diese nicht transparent sind. Damit war der gesamte Vorgang nicht grunderwerbsteuerbar. Auf die teilweise Steuerfreiheit kam es folglich nicht an; dem Finanzamt zufolge wäre der Vorgang zwar zu 40 % grunderwerbsteuerfrei gewesen, aber zu 60 % grunderwerbsteuerpflichtig. Der BFH widerspricht insoweit der Auffassung der Finanzverwaltung. Nach dem aktuellen Urteil bleibt die sog. Verlängerung der Beteiligungskette durch Einfügung einer Personengesellschaft grunderwerbsteuerlich unschädlich, wenn anschließend eine mittelbare Beteiligung in gleicher Höhe besteht, also neue unmittelbare oder mittelbare Gesellschafter nicht hinzugekommen sind. Quelle: BFH, Urteil vom 21.8.2024 – II R 16/22; NWB
